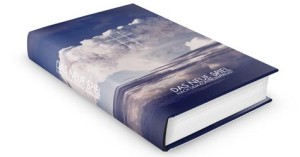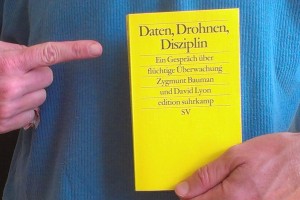Zwischen Krim-Krise und Hoeneß-Hype kommt die CeBit 2014 fast zu kurz. Wenn auch nicht ganz. Vor allem die große Debatte um Big Data verleiht der Computermesse eine weitere Dimension. Es weht ein Hauch von Snowden durch die Hallen. (Gut, ich war gar nicht dabei.) Jedenfalls für alle nachlesbar, hat Angela Merkel einen bedeutenden und entlarvenden Satz zum Thema Datenschutz formuliert: „Ich glaube, wir sind erst am Anfang dessen, was da zu leisten ist.“ What a wording!
Öffentlichkeit - Worum es hier geht:
Das Grundvertrauen ist weg. Weil Ökonomie und Technologie den Digitalen Wandel immer weiter vorantreiben. Weil die alten Regeln nicht mehr zu taugen scheinen und weil jeder Einzelne immer mehr können soll. In Echtzeit. Allmacht? Ohnmacht? Segen ? Fluch? Risiko? Chance? Leider alles zugleich. Der Auftrag der Medien für unsere Gesellschaft steht zur Diskussion.
Sinn oder Krise? Medienmenschen im Zweifel
Dem Blogger Wolfgang Michal, Motor von Carta, gelang vor kurzem ein Post, der ungewöhnlich häufig kommentiert wurde. Dabei handelte es sich nicht etwa um sein interessantes Hintergrundstück zum Ukraine-Konflikt – nein, die Selbst-Suche eines Netz-Publizisten im digitalen Medienwandel war sein Thema: „Braucht es uns noch?“.
Genauso aufschlussreich fand ich einen Beitrag des jungen Journalisten Andreas Grieß auf vocer, vor allem dank der Reaktionen darauf: „Die Medienbranche hat diese Generation nicht verdient“. Wir stecken mitten in Sinnkrisen und Generationskonflikten. Kein Grund zum Verzweifeln, sondern zum Nachdenken.
Kommunikation in der Krise: Der „Fall Edathy“
Für unsere Gesellschaft ist der „Fall Sebastian Edathy“ ein Gewinn- an schmerzlichen Erkenntnissen über das Leben in der Medienwelt. Wir lernen: Kommunikation und Krise gehören eng zusammen. Fragt sich fast, ob es da dieser Tage noch einen bedeutenden Unterschied gibt. Auch wenn die vordergründigen Stichworte „Kinderpornografie“, „Amtsgeheimnis“ und „Koalitionsfrieden“ lauten, im Zentrum dieser #Staatsaffaire steht die Kommunikation. Für die wir uns einfach nicht mehr genug Zeit nehmen (können).
Kontrollverlust als Dauerzustand
16 Millionen „Identitäten“ haben Online-Betrüger wohl geklaut. Wieder eine erhebliche Kränkung der Nutzer durch den Missbrauch digitaler Möglichkeiten. Kann der Staat uns besser schützen? Unwillig oder überfordert! Können uns Unternehmen aus der Patsche helfen? Sind doch selber datenhungrig! Nutzt Eigenvorsorge, also bis an die Zähne betoolen oder ins Funkloch ziehen? Oder sollten wir jetzt nicht radikalere Optionen denken? Es ist doch Post-Privacy. The Click after.
Die Arroganz der Ohnmacht
Die Neujahrsansprache von Sascha Lobo: Er warb für Optimismus in Zeiten des kaputten Internets und erzeugte damit einige Reaktionen, von geziert gewittert bis gekonnt gekontert. Von abgewogener Zustimmung bis zustimmender Ablehnung. Bleibt die Frage: Was nun? Auf der Suche nach einer Antwort stoßen wir auf die Ignoranz der Macht, aber auch auf die Arroganz der Ohnmacht.
Lobo: Das Internet ist kaputt – es lebe das Internet
Schöner Zufall, auch wenn vermutlich kein Zusammenhang besteht: Gestern noch habe ich blogöffentlich an Rechthaberei in der Digital-Debatte gelitten. Heute wagt es Sascha Lobo, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einen Irrtum einzugestehen. Das Internet sei eher Fluch als Segen. Kaputt das Netz, gekränkt seine Gemeinde. Eine fundamentale Schlussfolgerung aus den Erkenntnissen des Jahres 2013.
Siegen lernen ? Zum Vorbild USA
In meiner kleinen Linkliste auf dieser Seite habe ich auch „120 Sekunden“ von Martin Giesler aufgeführt. Der ZDF-Journalist betreibt einen privaten Blog, in dem er ein paar Bretter über den tiefen Graben zwischen der alten und der neuen Medienwelt verlegt. Besonders anregend fand ich seinen Post zu Entwicklungen in den USA, „die die Grenzen des Journalismus neu verhandeln“.
Weniger Daten sind mehr Demokratie
Auch der 10. Oktober 2013 hat seinen Hype: Start der deutschen Ausgabe des Online-Magazins „Huffington Post“. Für mich ein sehr guter Tag, um über ein ganz anderes Thema zu bloggen. Denn „nichts ist verblüffender als die einfache Wahrheit“, sagte uns schon der journalistische Altmeister Egon Erwin Kisch. Derzeit liegt die Wahrheit zum Medienwandel im Werk von Evgeny Morozov. Wirklich.
Gerade ist sein Buch „Smarte neue Welt. Digitale Technik und die Freiheit des Menschen“ erschienen, nachdem das amerikanische Original schon seit Monaten für interessante Diskussionen sorgt. Evgeny Morozov verlangt darin, den digitalen Wandel endlich zu politisieren und zu moralisieren. Vor allem den „Informations-Konsumismus“ will er bekämpfen. Denn sonst werde uns ökonomisches Kalkül und technologischer Fortschrittsglaube versklaven. Starker Tobak und doch sehr bekömmlich.
Sehen, hören und gruseln – „Darknet“
Ein übermotiviertes Mitglied der Piratenpartei hat gerade mit einer Drohne die Fünf-Prozent-Hürde unterflogen und das Gerät vor den Augen der Bundeskanzlerin abschmieren lassen. So kurz vor der Wahl versuchen viele, uns den Ernst der digitalen Lage klar zu machen. Aber das geht auch ohne Bruchlandung: Die neue Deutschland-Augabe der Online-Plattform „Motherboard“ zeigt das mit einer Web-TV-Dokumentation namens „Darknet“. Sie offenbart uns die kryptographisch verborgene, unzensierte Internet-Welt des Deep Web oder Hidden Web. Ein schrecklich interessanter Film.
Produziert wurde das Stück – das ebenso bei der BBC oder in der ARD laufen könnte – vom deutschen Ableger des angesagten Unternehmens „Vice“. 1994 in Montreal als Gratismagazin gegründet, bezeichnet es sich selbstvermarktend inzwischen als „internationales Medienimperium“, mit diversen Vertriebskanälen, vom Verlag bis zur Website. Musik, Mode, Kunst und Kultur bilden die Themenschwerpunkte. Aber auch investigative Stories und Technik gehören zum Angebot. „Ein neues Sprachrohr für eine neue Generation“ will Vice sein. Ist es vielleicht sogar schon.
Tom Littlewood leitet als Chefredakteur die deutsche Ausgabe. Und er macht als Presenter der Reportage Darknet nach all den theorielastigen Debatten über Snowden und die NSA das einzig Richtige: Littlewood reist dorthin, wo es weh tut. In einen dunklen Raum, in dem raffinierte Verschlüsselungstechnik allen Nutzern zweierlei zusichern: Anonymität und Straffreiheit. Diese verborgene Welt soll mindestens Tausend mal größer sein als das normale Internet, das wir über die Suchmaschinen kennen. Seine Bewohner sind Freaks und Freiheitskämpfer.
Ich bin etwa doppelt so alt wie die Vice- bzw. Motherboard-Zielgruppe und möglicherweise hat mich deshalb geradezu verstört, wie sich der Reporter mit Hilfe eines Fachmanns in einen offensichtlich riesigen ungezügelten Markt einloggt. Wo sich harte Drogen bestellen lassen wie bei Amazon Bücher. Wo Feinmechaniker nach Feierabend zurechtgefeilte Schusswaffen anbieten. Wo nette Onkels nach geeigneten Betäubungsmitteln für die minderjährige Nichte fragen. Darknet eben.
Dann aber die verblüffende Wende im Film: Der iranische Journalist Ehsan Norouzi schildert hautnah, wie überlebenswichtig ein Kommunikationsmittel ist, das die Staatsmacht nicht überwachen, also beherrschen kann. Ironischer Weise basiert das Hidden Web auf militärischer Technologie. Doch nun wenden Hacker die Verfahren an, um gesicherte Freiräume zu schaffen. Um verlorene Privatsphäre zurück zu erobern. Der Gründer von Torservers.net, Moritz Bartl, sieht sich denn auch als „Kämpfer für das Menschenrecht, auch gegen die Gesetze in einigen Ländern.“
Schnörkellos und schonungslos stellt die Dokumentation die beiden Seiten des Digitalen Freiheitskampfes nebeneinander. Ein Urteil fällt sie letztlich nicht. Eher lakonisch wirkt der Kommentar von Tom Littlewood: Das Internet sei weder gut noch schlecht, sondern einfach sehr mächtig. Wer der übermächtigen Überwachung von Staat und Konzernen entkommen wolle, dem bliebe nur das Darknet, mit all seinen Schattenseiten. Schließlich hätten wir selbst die Wahl:
Do we want the devil we know or the devil we don´t ?
Zum Teufel, was ist das bloß für eine Alternative? Genauso wie den iranischen Dissidenten, so schützt das verborgene Netz eben auch den perversen Onkel. Diese heillose Entscheidung steht an, weil wir staatlicher Macht nicht mehr vertrauen können. Weil wir Angst vor datenfressenden Unternehmen haben müssen, die unsere Träume schon kennen, bevor wir eingeschlafen sind.
Der coole Tom Littlewood hat vermutlich recht mit seinem Realismus – aber er darf nicht recht behalten. Das kann es noch nicht gewesen sein! Also erst mal im dunklen Wald pfeifen, schlage ich vor. Etwa so: Gerade durch Filme wie „Darknet“ entsteht wohl erst ein allgemeines Bewusstsein. Das wäre der erste Schritt auf einem dritten Weg zwischen den Highways to Hell.
Entmündigung für Selbstabholer
Es gibt Texte, die einen sehr aufregen. Nicht etwa, weil alles darin so neu oder provokant wäre. Sondern wegen ihrer schlichten Wahrheit und Klarheit. „Daten, Drohnen, Disziplin. Ein Gespräch über flüchtige Überwachung zwischen Zygmunt Bauman und David Lyon“, das ist für mich so ein Buch. Vor kurzem erst erschienen, könnte der Titel wie ein schnell zusammen gekloppter Kommentar zu Edward Snowdens Enthüllungen und der Diskussion um Spionage und Big Data wirken.
Aber dafür hätten sich die beiden Wissenschaftler wohl kaum hergegeben. Der Soziologe David Lyon von der Queen´s University in Kingston / Kanada gilt als einer der führenden Experten für Überwachung. Vom polnisch-britischen Soziologen und Philosophen Zygmunt Bauman stammt der Begriff „Liquid Modernity“. Kein Ausdruck beschreibt meiner Meinung nach so treffend die Verhältnisse des Digitalen Zeitalters.